Wie geht es nach der Reha weiter? Was Du jetzt wissen musst
Die Reha ist vorbei – und jetzt? Für viele beginnt genau dann die größte Herausforderung. Der Alltag wartet. Vielleicht bist Du körperlich oder psychisch noch nicht vollständig stabil. Die Arbeit ruft oder ist sogar in Gefahr. Gleichzeitig tauchen neue Fragen auf: Gibt es weiterhin Krankengeld? Welche Rolle spielt der Abschlussbericht? Was passiert, wenn Du nicht sofort wieder arbeiten kannst?
Ob nach einem Unfall, bei chronischen Beschwerden oder einer psychosomatischen Erkrankung – die Reha ist oft nur ein Teil der Genesung. Der Übergang danach erfordert Planung, Unterstützung und Klarheit. In diesem Artikel erfährst Du, was jetzt auf Dich zukommt und welche Möglichkeiten Du hast.
 Reha als Wegweiser – nicht als Abschluss
Reha als Wegweiser – nicht als Abschluss
Eine Reha hilft dabei, Deine Gesundheit zu stabilisieren. Ziel ist es, Deine Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen oder zu erhalten. Aber sie ist kein Wundermittel. Gerade bei langwierigen oder komplexen Erkrankungen reicht ein Reha-Aufenthalt oft nicht aus, um vollständig genesen zu können. Er dient eher als Orientierung: Was kannst Du wieder leisten? Wo liegen Grenzen?
Nach einer stationären Reha wegen eines Arbeitsunfalls zum Beispiel kann schnell klar werden: Der alte Beruf ist vielleicht nicht mehr möglich. Oder Du brauchst mehr Zeit, um Dich zu erholen. In solchen Fällen sollte frühzeitig über Nachsorge oder berufliche Alternativen gesprochen werden.
Abschlussgespräch: Ein entscheidender Moment
Am Ende der Reha findet ein Abschlussgespräch statt. Es ist mehr als ein formeller Termin. Du besprichst mit Ärzten, Therapeutinnen und Sozialdiensten, wie es weitergehen kann. Sie bewerten, ob Du aus medizinischer Sicht wieder arbeiten kannst oder nicht. Dabei wird Deine aktuelle Belastbarkeit eingeschätzt – körperlich, psychisch und beruflich.
Das Ergebnis fließt in den Abschlussbericht ein. Dieser wird an die Rentenversicherung, Deine Krankenkasse und – wenn Du möchtest – an Deine Hausarztpraxis geschickt. Du solltest darauf achten, eine Kopie für Dich zu erhalten. Der Bericht dient als Grundlage für alle weiteren Entscheidungen: Krankengeld, Nachsorge, berufliche Reha oder sogar Erwerbsminderung.
Was bedeutet „arbeitsunfähig aus der Reha entlassen“?
Wenn Du arbeitsunfähig entlassen wirst, bleibst Du weiterhin krankgeschrieben. Der Anspruch auf Krankengeld besteht, solange eine Arbeitsunfähigkeit vorliegt. Wichtig ist, dass die Krankschreibung nahtlos erfolgt. Vereinbare deshalb möglichst vor der Entlassung einen Termin bei Deiner Ärztin oder Deinem Arzt.
Falls Du nicht lückenlos krankgeschrieben bist, kann das zu Problemen führen. Die Krankenkasse könnte die Zahlung einstellen. Besonders bei chronischen Erkrankungen oder nach einer psychosomatischen Reha ist das ein häufiges Thema. Achte also darauf, dass keine Versorgungslücke entsteht.
Kündigung vor Reha-Antritt – und dann?
In manchen Fällen erhalten Betroffene eine Kündigung, bevor die Reha überhaupt beginnt. Das kann verunsichern – aber es ist nicht automatisch das Ende aller Ansprüche. Auch wenn Dein Arbeitsverhältnis endet, kannst Du weiterhin Krankengeld bekommen, solange Du krankgeschrieben bist.
Zudem gilt unter bestimmten Voraussetzungen ein besonderer Kündigungsschutz. Hast Du länger als sechs Monate im Betrieb gearbeitet oder besitzt Du eine anerkannte Schwerbehinderung, können zusätzliche Regelungen greifen. In solchen Situationen lohnt es sich, rechtlichen Rat einzuholen – zum Beispiel bei Sozialverbänden oder Fachanwälten.
Was passiert, wenn Du eine bewilligte Reha nicht antrittst?
Wurde Dir eine Reha genehmigt, bist Du in der Pflicht, sie anzutreten. Ein Nichtantritt ohne triftigen Grund kann Folgen haben – etwa Kürzungen beim Krankengeld. Denn die Reha gilt als Maßnahme zur Wiederherstellung Deiner Arbeitsfähigkeit. Verweigert man diese, kann das als fehlende Mitwirkung gewertet werden.
Es gibt aber Ausnahmen. Akute Krankheiten, familiäre Notfälle oder organisatorische Hürden können akzeptierte Gründe sein. Wichtig ist: Sprich rechtzeitig mit der Krankenkasse oder dem Reha-Träger. Ein Attest kann helfen, wenn Du aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen kannst.
Wie lange dauert es, bis der Reha-Bericht da ist?
Nach der Entlassung dauert es meist ein bis drei Wochen, bis der Reha-Bericht erstellt und verschickt wird. In manchen Fällen kann es auch länger dauern – je nach Klinik oder Komplexität des Falls. Du kannst eine Kopie direkt anfordern oder später über Deine Arztpraxis einsehen.
Der Bericht enthält medizinische Einschätzungen, Angaben zur Leistungsfähigkeit und Empfehlungen für Nachsorge oder berufliche Maßnahmen. Achte darauf, dass der Bericht vollständig ist. Fehlerhafte oder unvollständige Angaben können später zu Problemen führen – zum Beispiel beim Krankengeld oder bei Reha-Folgeanträgen.
Reha-Nachsorge: Unterstützung, die den Unterschied macht
Mit der letzten Behandlung in der Reha endet nicht automatisch die Begleitung. Gerade jetzt zeigt sich, wie wichtig strukturierte Nachsorgeprogramme sein können. Viele Menschen fühlen sich nach der Rückkehr in den Alltag überfordert. Der gewohnte Rhythmus fehlt, körperliche Einschränkungen bleiben, psychische Belastungen tauchen wieder auf. Hier setzt die Reha-Nachsorge an.
Programme wie IRENA (Intensivierte Rehabilitationsnachsorge) oder T-RENA (Trainingstherapeutische Reha-Nachsorge) helfen dabei, die Fortschritte aus der Reha zu festigen. Sie finden wohnortnah statt – meist in Therapiezentren oder Kliniken – und laufen über mehrere Wochen. Die Teilnahme ist freiwillig, wird aber von Ärztinnen und Therapeuten häufig empfohlen. Je nach Programm nimmst Du ein- bis zweimal pro Woche teil. Inhalte können Bewegungstherapie, Gerätetraining oder psychologische Gespräche sein.
Wer nach einer psychosomatischen Reha Schwierigkeiten im Alltag erlebt, kann auch psychotherapeutische Nachsorge erhalten. Viele Einrichtungen bieten zudem Gruppenangebote oder digitale Formate an – ideal, wenn Du keinen direkten Zugang zu einer Praxis hast oder beruflich eingebunden bist.
Wiedereinstieg in den Job – Schritt für Schritt mit dem Hamburger Modell
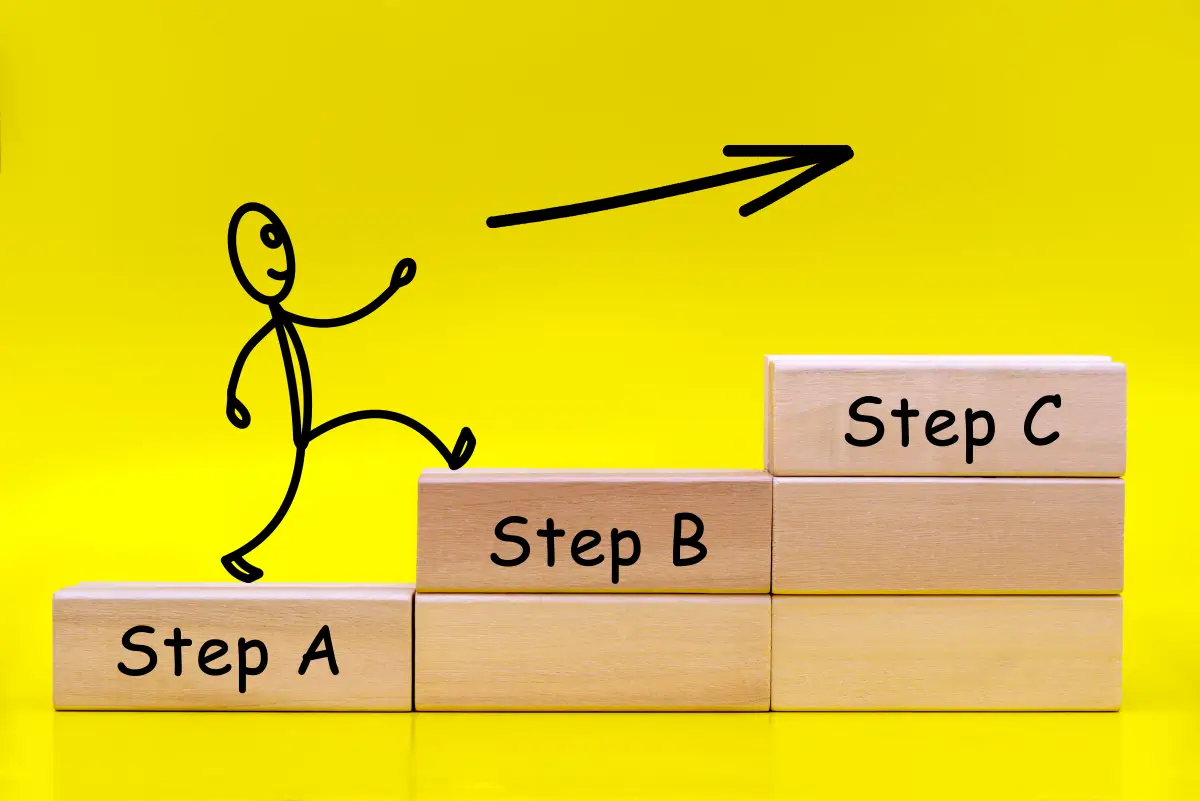 Wenn Du nach der Reha in Deinen Beruf zurückkehren möchtest, ist die stufenweise Wiedereingliederung oft die beste Lösung. Dieses Modell – auch als Hamburger Modell bekannt – ermöglicht Dir, langsam wieder in den Arbeitsalltag einzusteigen. Du beginnst mit wenigen Stunden pro Tag. Die Arbeitszeit wird dann schrittweise erhöht.
Wenn Du nach der Reha in Deinen Beruf zurückkehren möchtest, ist die stufenweise Wiedereingliederung oft die beste Lösung. Dieses Modell – auch als Hamburger Modell bekannt – ermöglicht Dir, langsam wieder in den Arbeitsalltag einzusteigen. Du beginnst mit wenigen Stunden pro Tag. Die Arbeitszeit wird dann schrittweise erhöht.
Während der Wiedereingliederung bist Du weiterhin arbeitsunfähig gemeldet. Dein Arbeitsverhältnis bleibt bestehen, aber Du erhältst kein Gehalt vom Arbeitgeber. Stattdessen bekommst Du weiterhin Krankengeld oder Übergangsgeld – abhängig vom Träger. Die Dauer der Wiedereingliederung variiert. In vielen Fällen dauert sie zwischen vier und acht Wochen.
Die konkrete Ausgestaltung erfolgt gemeinsam mit Deinem Arzt, der Krankenkasse und dem Arbeitgeber. Wichtig: Du kannst die Wiedereingliederung jederzeit abbrechen, wenn sich Deine gesundheitliche Situation verschlechtert. Gleichzeitig kannst Du sie verlängern, wenn Du mehr Zeit brauchst.
Das Modell ist besonders hilfreich bei längeren Krankheitsphasen oder psychischen Belastungen. Es hilft Dir, Sicherheit zu gewinnen und Überforderung zu vermeiden – körperlich und emotional.
Wenn der bisherige Job keine Option mehr ist: Berufliche Reha
Manchmal zeigt sich während oder nach der Reha, dass eine Rückkehr in den alten Beruf nicht mehr möglich ist. Gründe können körperliche Einschränkungen, psychische Belastungen oder ein dauerhaft veränderter Gesundheitszustand sein. In diesen Fällen kommt eine berufliche Reha in Frage – offiziell: „Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“.
Diese Leistungen werden durch die Rentenversicherung oder andere Träger organisiert. Sie können Dir helfen, neue berufliche Perspektiven zu entwickeln. Möglichkeiten sind zum Beispiel:
-
Umschulungen oder Weiterbildungen, wenn Dein bisheriger Beruf dauerhaft nicht mehr ausgeübt werden kann
-
Arbeitserprobungen, um herauszufinden, welche Tätigkeiten noch möglich sind
-
Technische Hilfsmittel, die Deine Arbeitsfähigkeit unterstützen – etwa ergonomische Geräte oder spezielle Arbeitsplatzausstattungen
-
Begleitende Unterstützung, etwa durch Jobcoaches oder Integrationsdienste
Voraussetzung ist meist, dass im Reha-Abschlussbericht eine eingeschränkte Erwerbsfähigkeit festgestellt wurde. Der Antrag auf berufliche Reha kann auch unabhängig gestellt werden – etwa durch die Arbeitsagentur oder bei der Rentenversicherung.
Wenn nichts mehr geht: Erwerbsminderung als letzte Option
Es gibt Situationen, in denen trotz aller Reha-Maßnahmen und Nachsorge keine Rückkehr ins Berufsleben möglich ist. Wenn Deine Leistungsfähigkeit dauerhaft eingeschränkt ist, kannst Du eine Erwerbsminderungsrente beantragen.
Diese Rente unterscheidet sich von der Altersrente. Sie wird dann gezahlt, wenn Du auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nur noch weniger als sechs Stunden pro Tag arbeiten kannst. Dabei spielt es keine Rolle, ob Du Deinen alten Beruf noch ausüben kannst – entscheidend ist die allgemeine Arbeitsfähigkeit.
Es gibt zwei Varianten:
-
Volle Erwerbsminderungsrente: Wenn Du weniger als drei Stunden täglich arbeitsfähig bist
-
Teilweise Erwerbsminderungsrente: Wenn Du zwischen drei und sechs Stunden täglich belastbar bist
Der Antrag erfolgt bei der Deutschen Rentenversicherung. Grundlage sind medizinische Gutachten, ärztliche Berichte und der Reha-Abschlussbericht. In vielen Fällen wird die Rente zunächst befristet gewährt – mit späterer Überprüfung.
Wenn Du unsicher bist, ob ein Antrag sinnvoll ist, kannst Du Dich bei Sozialdiensten oder unabhängigen Beratungsstellen informieren. Auch Sozialverbände helfen bei der Einschätzung und Antragstellung.
Fazit: Rückkehr in den Alltag braucht Zeit – und die richtigen Schritte
Die Reha markiert oft nicht das Ende einer Erkrankung, sondern den Anfang eines neuen Abschnitts. Viele Fragen ergeben sich erst im Anschluss: Bin ich wieder arbeitsfähig? Brauche ich Unterstützung? Was passiert, wenn ich nicht in den alten Beruf zurückkehren kann?
Die gute Nachricht: Du bist nicht allein. Es gibt strukturierte Nachsorgeangebote, flexible Wiedereinstiegsmodelle und berufliche Reha-Maßnahmen, die Dir helfen können. Selbst wenn eine Rückkehr ins Berufsleben nicht möglich ist, gibt es Absicherungen wie die Erwerbsminderungsrente.
Wichtig ist, dass Du aktiv bleibst. Nimm Unterstützung an, sprich mit Ärztinnen, Rehaberatern und Krankenkassen. Achte auf Deinen Körper – und auch auf Dein Gefühl. Nicht jede Lösung ist sofort sichtbar, aber Schritt für Schritt findest Du Deinen Weg zurück ins Leben.
Gesund werden ist kein gerader Weg. Aber Du musst ihn nicht allein gehen.







